Am 3.3.2020 veranstaltete der Gesprächskreis Bildungspolitik eine Online-Diskussion rund um die Studie „Ökonomisierung schulischer Bildung – Analysen und Alternativen“, die Tim Engartner im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des GK Bildungspolitik verfasst hat.
Ein Video der Veranstaltung steht nun Online auf der Seite der RLS NRW und auf Youtube.
Neben dem Autor der Studie waren Ilka Hoffmann, im GEW-Vorstand für den Organisationsbereich Schule zuständig, und Jürgen Kaube, Mitherausgeber der FAZ und Bildungsjournalist auf dem virtuellen Podium. Moderiert wurde das Gespräch von Karl-Heinz Heinemann.
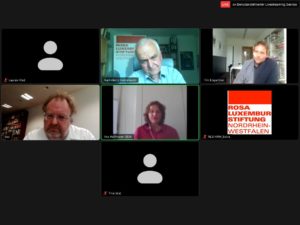
Zunächst stellte Engartner die Kernpunkte seiner Studie vor, denn die Ökonomisierung schulischer Bildung zeigt sich längst nicht mehr nur durch das private Sponsoring von Schulfesten. Unternehmen, Stiftungen und Verbände, darunter auch 20 der 30 deutschen DAX-Unternehmen, entwickeln Unterrichtsmaterialien, veranstalten Lehrer*innenfortbildungen und übernehmen damit eine eigentlich staatliche Aufgabe. Auch der Markt für private Nachhilfeanbieter und Franchise-Ketten wie Schülerhilfe und Co wächst stetig. Privatschulen erheben vielfach Schulgeld, trotz im Grundgesetz verankertem Sonderungsverbot. Statt Politik und Sozialwissenschaften wird ein Fach „Wirtschaft“ gefordert, und die durch die Corona-Krise beschleunigte Digitalisierung der Schule ist ein weiteres Einfallstor für Unternehmen wie Google, Apple oder Microsoft. Damit, so Engartners Befund, wird nicht nur die Qualität von Unterricht in die Hände außerstaatlicher Akteur*innen mit sehr unterschiedlichen Interessen gelegt, es findet auch ein „Kampf um die Köpfe“, also um die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler statt. Der Begriff von Bildung, das konstatiert auch Jürgen Kaube, verändert sich ebenfalls.
Aber was, fragt Kaube, wenn die Privatschulen durch ihre bessere Ausstattung eben die bessere Bildung bieten können? Um die Geräte geht es laut Ilka Hoffmann überhaupt nicht: Es gehe um einen kritischen Umgang mit Digitalisierung, der immer von einem positiven Menschenbild geleitet werden müsse. Denn viele Lernprogramme seien eher auf das Sammeln von Daten aus, und Datenmanagement habe direkte Auswirkungen auf die Didaktik. Was macht es mit dem Unterricht, wenn Lehrer*innen über Lernsoftware messen können, wer seine Aufgaben wie schnell erledigt und wer vielleicht eine besonders kurze Aufmerksamkeitsspanne hat? Scheinbar wird Lernen dadurch individualisiert, doch tatsächlich werden die Individuen nach Standards ausgerichtet. Am Ende geht es eben immer auch um die Frage, wie man mit Heterogenität umgeht, so Heinemann. Hier stimmt Kaube zu: Schule müsse beides leisten – die Vermittlung von Wissen um den Konjunktiv ebenso wie die Bewertung von Unterschieden zwischen Schülern in Form von Notengebung, Selektion für das spätere Berufsleben also. Daran, dass es eben unterschiedliche Leistungen gebe und sich immer einige Schüler*innen langweilen, während andere unterfordert sind, und der Unterricht vor allem den „Durchschnitt“ erreicht, werde sich aber nie etwas ändern. Hier widerspricht Hoffmann vehement: Es gäbe durchaus Konzepte, mit denen man auch heterogene Klassen sehr gut unterrichten könne, wie zum Beispiel das Lernen am gemeinsamen Gegenstand nach Feuser oder die bereits 500 Jahre alte Didaktik von Comenius. Kaube weist darauf hin, dass es ja sehr unterschiedliche Dimensionen von Heterogenität gäbe. Engartner hält an dieser Stelle fest, dass Heterogenität keinen Wert an sich darstellt, und es immer um den Umgang damit ankomme. Hier, so seine Analyse in der Studie, versagt Schule aktuell komplett.
Man müsse aufpassen, dass das Land der Dichter und Denker nicht zum Land der Stifter und Schenker werde. In die Ökonomisierung des Bildungswesens fällt aber nicht nur die Einflussnahme privater Initiativen und Unternehmen, sondern auch der zunehmende Wettbewerb unter den Schulen selbst, der sich in der Entwicklung von Schulprofilen ausdrückt. Dabei habe, so Heinemann, eine Schule mit starkem Förderverein im wohlhabenden Köln-Marienburg eben deutlich bessere Chancen als eine Grundschule in Köln-Kalk. Kaube entgegnet, dass man soziale Ungleichheit nicht einfach wegbilden könne. Wenn es darum gehe, bräuchte es andere gesellschaftliche Umbrüche als eine bloße Bildungsreform. Dieser Aussage können sich alle anschließen, doch Hoffmann betont: Schule ist nicht Ursache der gesellschaftlichen Spaltung, aber ein Katalysator für sie. Deshalb müsse man, so Heinemann, Ungleiches eben auch ungleich behandeln und gerade Schulen in sogenannten Problembezirken besonders viel staatliche Förderung zukommen lassen.
Engartner verweist auf die komplizierte kommunale Finanzarchitektur, und Kaube zeigt sein Unverständnis darüber, dass die finanzielle Unterstützung in Deutschland vor allem in höhere Jahrgänge fließt, obwohl doch längst klar ist, dass die frühe Selektion in Deutschland soziale Ungleichheit zementiert. Das sei jedoch, so Heinemann, eben Ausdruck davon, wer seine Interessen durchsetzen kann – und wenn es um auf dem Arbeitsmarkt verwertbare Abschlüsse geht, ist das Interesse des Staates eben besonders groß, wie sich auch in der Corona-Krise gezeigt hat. Schüler*innen, die nicht kurz vor ihren Prüfungen stehen, oder eben „nur“ einen Hauptschulabschluss machen, wurden von der Diskussion über das diesjährige Abitur völlig überschattet. Engartner fasst es in der Frage zusammen: Will Bildung soziale Unterschiede nivellieren oder zumindest versuchen, sie auszugleichen? Ist letzteres der Fall, dann muss die Investitionsbereitschaft im Bereich Bildung deutlich höher sein.
