Der bildungsindustrielle Komplex
– Schule und Unterricht im Wettbewerbsstaat
Hier das Video von den Vorträgen
Am 15. Dezember hat der GK Bildungspolitik zu einer Online-Diskussion mit Prof. Richard Münch und Klaus Bullan eingeladen. Zu Beginn stellt Münch seine Thesen aus dem Buch „Der bildungsindustrielle Komplex“ vor, die hier in einer Kurzversion nachgelesen werden können. Münch nähert sich dem Thema weniger aus einer praktisch-politischen, sondern vor allem aus einer soziologischer Perspektive. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf den USA. Der bildungsindustrielle Komplex bezeichnet Münch zufolge die zunehmende Beteiligung von Unternehmen am Bildungbereich und an der Organisation des Schulwesens. Münch listet verschiedene Akteure, die den bildungsindustriellen Komplex bilden (siehe Abbildung aus PPT). Die OECD ist dabei in einer zentralen Position, um die sich andere Akteure sammeln. Die Idee ist, durch stärkeren Wettbewerb zwischen Schulen, letztlich aber auch zwischen Nationen zu besseren Bildungsleistungen zu kommen. Dabei spielen in der Bildungsforschung mittlerweile Ökonomik, Psychometrie und Statistik eine größere Rolle als die Erziehungswissenschaften. Unternehmen wie Pearson sind in der Durchführung standardisierter Tests an öffentlichen Schulen eingebunden, Beratungsunternehmen wie McKinsey oder Ernst & Young veröffentlichen Papiere mit Titeln wie „How the world’s most improved school systems keep getting better“, und auch Stiftungen wie beispielsweise die Bill and Melinda Gates Stiftung sind aktiv und betreiben das, was Münch philantropischen Kapitalismus nennt. Auch Hedge Fonds der Wall Street sind Teil des Komplexes, beispielsweise wenn es um die Investition in Privatschulen geht. Seit Clinton 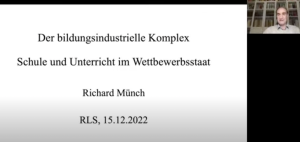 locken Steuervorteile, wenn neue ‚charter schools‘ in Armenvierteln entstehen.
locken Steuervorteile, wenn neue ‚charter schools‘ in Armenvierteln entstehen.
Aus diesem Komplex ist Münch zufolge eine globale Bewegung entstanden, die unter dem Namen New Public Management im Bildungssystem Fuß gefasst hat. Das New Public Management geht davon aus, dass öffentliche Verwaltungen nicht effizient genug arbeiten und daher einer anderen Steuerung bedürfen. Dabei orientiert man sich an den Management für Unternehmen, in der Erwartung, dass dies zu einer Effizienzsteigerung im öffentlichen Bereich führen würde. Münch verweist auf Verwaltungsreformen unter Margret Thatcher, die in Großbritannien auf das Bildungssystem übertragen wurden. Die staatliche Zielsetzung und Regulierung sieht Münch in einer Anhebung der Leistungsziele, wobei Standardisierung und Regulierung dem Staat auch direkte Intervention ermöglicht, beispielsweise wenn Schulen Ziele nicht erreichen – diese werden in den USA teilweise einfach geschlossen und durch neue Schulen ersetzt. Den Eltern soll die ‚Konsumentensouveränität‘ zurückgegeben werden: Wie auf einem Markt können sie die ‚beste‘ der Schulen wählen, die Schulen untereinander geraten in einen Wettbewerb um ihre ‚Kunden‘, die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler. Der neoliberale Ökonom Milton Friedman hat bereits 1956 die Idee von Bildungsgutscheinen entwickelt. In der Zeit des bildungsindustriellen Komplexes werden behavioristisch inspirierte Marktmechanismen eingesetzt, um die Effizienz und Qualität von Leistungen durch Anreize zu steigern. Ein Beispiel aus Deutschland wäre die kürzlich wieder von der FDP erhobene Forderung, Lehrkräfte anhand ihrer erbrachten Leistungen zu bezahlen und so einen finanziellen Anreiz zu schaffen, damit Lehrkräfte besser und effizienter arbeiten.
In den USA gab es ab den 1960er-Jahren verschiedene Reformversuche, um die nicht nur von den Black Panthers beklagte Bildungsungerechtigkeit in den USA zu verbessern, vom Equality of Educational Opportunity (1966) bis zum Every Students Suceeds Act (2015). Doch nach wie vor gelte, so Münch: It’s all family. Wer den familiären Hintergrund eines Kindes kennt, kann die Bildungschancen ziemlich klar abschätzen. Ab Beginn der 2000er Jahre sei beispielsweise mit dem No Child Left Behind Act die Gründung von Charter Schools gefördert worden. Bei jedem dieser – meist schnell verabschiedeten – Reformversuche waren die Akteure der Bildungs- und Beratungsindustrie involviert. Doch allen Reformen zum Trotz: Nirgendwo wurde ein Erfolg erzielt, konstatiert Münch.
Anschließend wirft der Autor einen Blick nach Großbritannien, wo ebenfalls mit Beginn der neoliberalen Ära marktförmige Reformen durchgeführt wurden. Beginnend mit dem Educational Reform Act von 1988 wurde mehr Autonomie für Schulen in Entscheidungen und Budgetierung erreicht. Auch in Schweden, einem sozialdemokratisch geprägten Land, zeigt sich: In den 1990er Jahren werden auch hier neoliberale Reformen eingeführt, die öffentlich finanzierte Privatschulen zuließen, ein standardisiertes Curriculum und Leistungstest umfassten. Finnland war zurückhaltender – ein Grund, wieso das Land oft als Vorbild für schulische Bildung gelte. Münch verweist auf die homogene Bevölkerungsstruktur in Finnland, die bei der Diskussion um Bildungserfolge oft vergessen werde. Doch auch Finnland folgt dem Trend zu mehr Schulautonomie und freier Schulwahl.
In Deutschland ist vor allem der PISA-Schock von 2000 ein einschneidendes Ereignis. Es folgten auch hier die Forderung nach mehr Schulautonomie bei gleichzeitig vermehrter Leistungsdokumentation. Ein länderübergreifendes Bildungsmonitoring sowie Bildungsstandards wurden eingeführt, ein bürokratischer Apparat entstand, der dafür sorgen sollte, dass die schulischen Leistungen deutscher Schüler*innen sich im internationalen Vergleich verbessern. Unter der Beratung der Bertrelsmannstiftung wird dabei die eigenverantwortliche Schule zum Ideal. Die Schulleitungen bekommen zwar größere Spielräume, müssen jedoch auch mehr dokumentieren. Die Tätigkeit der Lehrkräfte verlagert sich immer stärker von pädagogischen zu administrativen Tätigkeiten. Dies ist nicht nur mit erheblichem bürokratischem, sondern auch mit finanziellen Aufwand verbunden. Der Niedersächsische Landesrechnungshof beziffert die Kosten im Jahr 2016 auf 421 Millionen Euro. Doch was wurde damit eigentlich erreicht? Eigentlich nichts, so Münch. Auch die neueren PISA-Evaluationen zeigen: Schulautonomie hat kaum einen Einfluss auf den Bildungserfolg. Weiterhin bleibt die soziale Herkunft entscheidend.
Klaus Bullan kommentiert die Thesen Münchs zwar ebenfalls als Soziologe, allerdings aus einer gewerkschaftlichen und damit bildungspolitisch orientierten Perspektive. Es sei verdienstvoll, dass Münch den Zusammenhang zwischen schulischer Bildung, Schulsystem und den unterliegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen darstellt. Die Stoßrichtung der Kritik, so Bullan, sei also richtig. Die Kritik am bildungsindustriellen Komplex müsse jedoch auch den vorauseilenden Gehorsam staatlicher Akteure umfassen. Dazu gehört die Übernahme betriebswirtschaftlicher Kennziffern, beispielsweise des New Public Managements.
Bullan beginnt damit, die ökonomischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte zu beschreiben, wie Münch sie in seinem Buch darstellt. Das Ende des prosperierenden, fordistisch genannten Kapitalismus sei mit dem Aufkommen von Krisen einhergegangen. Dies wird von Münch als Übergang vom Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat beschrieben – ein Punkt, der laut Bullan diskutierenswert ist. Denn Münch behauptet, dass aufsteigende Arbeiterkind habe dem Kind der oberen Schichten damals durch seinen Aufstieg keinen Platz weggenommen. Hat sich das heute geändert? In der Mitte des 20. Jahrhunderts dominierte ein strikt nach sozialer Herkunft gegliedertes Bildungssystem. Prosperität stellte sichere Arbeitsplätze für alle bereit, relativ unabhängig von der Qualifikation. Daher konnte die Bildungsexpasion gelingen: Bildungsaufstieg ermöglichte vielen Menschen aus niedrigeren Schichten den Zugang zur Hochschule. Doch die Schranken der Klassengesellschaft seien auch damals nicht überwunden worden. Mit dem Zugriff des Neoliberalismus in Wirtschaft und Gesellschaft begann die Kehrtwende. In diese Zusammenhänge müsste der Übergang von ‚Wohlfahrt‘ zu ‚Wettbewerb‘, den Münch anführt, eingeordnet werden. Bullan zufolge wird unterschätzt, wie stark der Druck durch die veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen zustande kamen und wie wenig durch die Expansion des Bildungswesens. Denn es ist nicht der Ausbau von Bildungschancen, der zu einer stärkeren Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt geführt hat, sondern die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen.
Der Philologenverband taugt laut Bullan nicht als Kronzeuge gegen diese Entwicklung, da er einen rückwärtsgewandte Kritik am Bildungssystem formuliert, indem er Akademisierungswahn und die Inflation von Bildungstiteln beklage, statt die eigentlichen Ursachen anzugehen. Das Ende der humanistischen Bildung wird beklagt, da die ‚gute Bildung‘ traditionell immer damit einherging, dass sie nur einer Elite zur Verfügung stand. Bis zum Ende der 60er Jahre gab es auch in Deutschland Abiturientenquoten von 10%. Jede Kritik am heutigen Bildungssystem, auch daran, wie es durch den bildungsindustriellen Komplex unter Druck stehe, sollte Bullan zufolge diese historischen Entwicklungen mitbedenken. Denn die größten Kritiker von Pisa seien der Philologenverband und Joseph Kraus, so könnte man nach der Lektüre des Buches annehmen, während sie eigentlich vor allem reaktionäre Positionen vertreten. Ein „Früher war alles besser“ könnte das Missverständnis sein, das beim Lesen des Buches zum bildungsindustriellen Komplex entsteht.
Zurück zum Neoliberalismus: Heute, im Unterschied zur Expansionsphase, stünden die öffentlichen Haushalte massiv unter Druck, erläutert Bullan. Sparzwänge und soziale Spaltung nehmen immer weiter zu. Auch der Druck auf die Eltern nehme so zu, die ihren Kindern eine bestmögliche Bildung ermöglichen wollen, um ihren Erfolg auf dem Arbeitsmarkt in unsicheren ökonomischen Zeiten abzusichern. Output-Orientierung nennt sich das in betriebswirtschaftlicher Sprache. Vor dem Hintergrund einer nicht unrealistischen Angst vor Arbeitslosigkeit sei der Wunsch, dem Kind möglichst gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen, aus Perspektive der Eltern verständlich und nicht notwendig nur Ausdruck eines Distinktionsbedürfnisses.
Anschließend geht Bullan auf die von Münch dargestellten Differenzen zwischen dem Bildungssystem in Deutschland und den USA ein. Schule in Deutschland orientiere sich Münchs Buch zufolge bisher an drei Säulen: Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene, bürokratische Regelungen der Kultusbürokratie und an Lehrkräften und ihren Berufsverbänden. Dieser Dreiklang verhindere bisher noch, dass sich kapitalistische Verwertungsinteressen an deutschen Schulen durchsetzen können. Diese Einschätzung teilt Bullan – nur könne von demokratischer Beteiligung der Eltern und Schüler*innen an Bildung nicht gesprochen werden.
Münch kritisiere, dass selbst wenn alle das mittlere Kompetenzniveau erreichen würden, kein Aufstieg in die Mitte der Gesellschaft für alle möglich wäre. Bullan zufolge wird so der Konkurrenzkampf um Zertifikate von Münch als Nullsummenspiel betrachtet: Wenn jemand absteigt, muss jemand aufsteigen. Die Geschichte der BRD habe jedoch gezeigt, dass die Veränderungen der Gesellschaft auch mit höheren Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt einhergehen. Umfassende Bildung dürfe daher nicht gegen die gern verurteilte „employability“ ausgespielt werden – beides sei wichtig, um demokratische Teilhabe zu ermöglichen. Bildung bedeute nicht nur die Möglichkeit zum Aufstieg, sondern auch die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und sich so an politischen Prozessen beteiligen zu können.
Abschließend merkt Bullan an, dass er die Vorstellung, dass ein übermächtiger Komplex Zugriff auf das Bildungswesen erhalten hat, kritisch sieht. Es gebe Möglichkeiten, Eltern und Schüler*innen klar zu machen, dass das Bildungssystem veränderbar ist und Bildung für alle Kinder möglich ist. Die Demokratisierung des Bildungsbereichs sieht Bullan als Voraussetzung dafür, dem bildungsindustriellen Komplex etwas entgegensetzen zu können.
Münch betont, sich als Wissenschaftler nicht auf eine politische Seite stellen zu wollen – auch nicht auf die des Philologenverbandes. Er verweist auf Ulrich Becks Fahrtstuhleffekt: Alle Mitglieder der Gesellschaft sind im gleichen Aufzug und können nach oben fahren, also fahren auch die ‚unteren‘ Schichten mit nach oben. Wenn dann ein Arbeiterkind eine Hochschulausbildung absolviert und Ingenieur wird, und es gibt mehr Ingenieursplätze, dann ist es ein ganz normaler Aufstieg. Wo ist also der Bruch? Bildungsinflation bedeutet nicht einfach, dass es zu viele Abiturient*innen gibt und das Abitur ‚entwertet‘ werde, gemeint sei vielmehr: Was ist mein Bildungszertifikat wert, in Umsetzung in Bildungsrenditen, sprich Einkommen? Die Chance auf ein gutes Einkommen werde zunehmend abhängiger von der Performance auf dem individuellen Markt und weniger von kollektiv erstrittenen Errungenschaften, beispielsweise Tarifverträgen.
